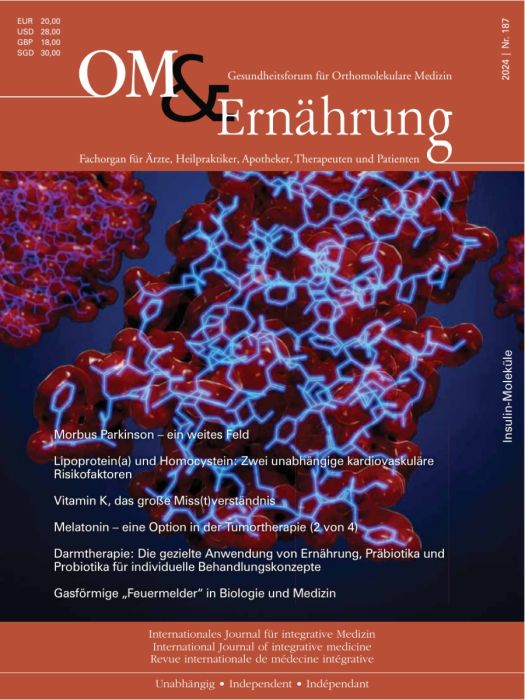Melatonin in der Tumortherapie – eine Option? (Teil 2)
Dr. med. Matthias Kraft
Dr. med. Kurt Mosetter
Prof. Dr. Dr. med. Ben Pfeifer
Einleitung Seit fast 30 Jahren haben viele Krebsforschungsgruppen eine große Menge an experimentellen invitro- und in-vivo-Daten generiert, die belegen, dass Melatonin an verschiedenen Stellen im Krebsgeschehen, von der initialen Zellproliferation bis hin zur Invasion und Metastasierung, Einfluss nimmt. Das Hormon greift in weitere, zahlreiche biologische Prozesse wie den Schlaf-Wach-Rhythmus und die innere Uhr, der Modulation des Immunsystems, der Zytokin-Produktion, dem oxidativen Stress, und bei der sexuellen Reifung ein, wobei multiple intrazelluläre Signalwege beteiligt sind [1]. Die ersten Studien zum Thema Melatonin und Krebs konzentrierten sich auf hormonabhängig wachsende Tumore, hauptsächlich das Mammakarzinom [2]. In späteren Jahren kristallisierte sich heraus, dass Melatonin das Wachstum vieler anderer, hormonunabhängig wachsender Tumorentitäten beeinflusst. Hierzu zählen unter anderem Karzinome des Pankreas, des Magens, des Kolons, das Glioblastom, das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom, und die Leukämien [3]. Zu den antineoplastischen Wirkungen von Melatonin gehört die Hemmung der Gefäßneubildung (Angiogenese), die Modifikation des Tumorstoffwechsels, die Stärkung der Immunüberwachung in der Tumormikroumgebung (TME) sowie andere biologische Prozesse, die an der Tumorausbreitung (Metastasierung) beteiligt sind. Hierzu zählt z. B. die epithelial-mesenchymale Transition (EMT), ein dynamischer Prozess, der aus der Entdifferenzierung einer Tumorzelle von einem epithelialen Zustand in einen eher mesenchymalen Phänotyp besteht. Dies führt zu Veränderungen in der Zellpolarität, Mobilität und Funktionalität. Die EMT erleichtert die Freisetzung von Tumorzellen aus dem Zellverband des Haupttumors und trägt damit zum Fortschreiten von in-situ befindlichen zu einem invasiv wachsenden Karzinom bei [4]. Viele Studien belegen, dass die gleichzeitige Verabreichung von Melatonin mit einigen Chemotherapeutika die Chemosensitivität der Krebszellen erhöht und gleichzeitig die Nebenwirkungen der toxischen Therapie auf gesunde Zellen begrenzt. Das Zirbeldrüsenhormon kann nachweislich auch die Arzneimittelresistenz verschiedener Krebsarten aufheben [1, 5].
| Seiten | 19 |
|---|---|
| Autor | Dr. med. Matthias Kraft; Dr. med. Kurt Mosetter; Prof. Dr. Dr. med. Ben Pfeifer |