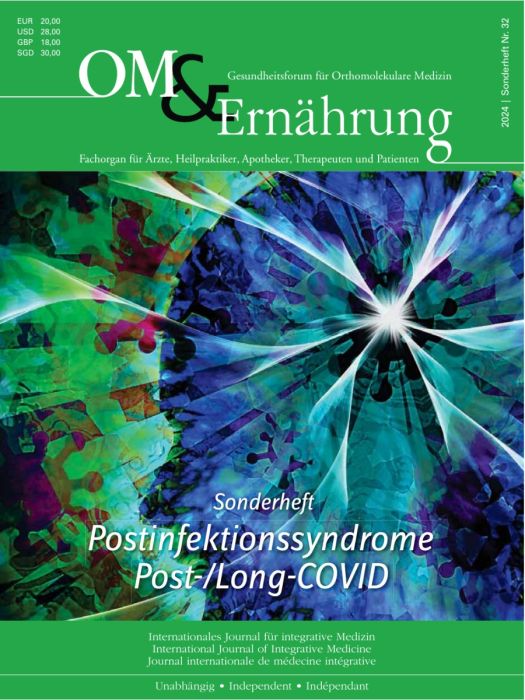Bedeutung von Autoantikörpern gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) für die Diagnose eines Postinfektionssyndroms
Dr. rer. nat. et med. hab. Stephan Sudowe
Die meisten Menschen genesen nach einer Infektion mit dem SARS-Coronavirus Typ 2 (SARS-CoV-2) ohne weitere Folgen. Ein Teil der an COVID-19 Erkrankten erholt sich allerdings langfristig nicht von der Infektion, sondern fühlt sich anhaltend erschöpft, selbst kleinste Anstrengungen im Alltag werden zum Kraftakt. Die typischen körperlichen und geistigen Symptome dieser als Long- oder Post-COVID-Syndrom bezeichneten Erkrankung weisen starke Parallelen zu der komplexen neuroimmunologischen Erkrankung Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrom (ME/CFS) auf. Auch beim ME/CFS wird ein Zusammenhang mit einer vorangegangenen Virusinfektion angenommen. Die genauen pathophysiologischen Mechanismen, die dieser unter dem Begriff Postinfektionssyndrom zusammenzufassenden Gruppe von Erkrankungen zu Grunde liegen, sind bislang größtenteils noch ungeklärt. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass durch die Virusinfektion induzierte Autoimmunprozesse grundlegend sowohl an der Entstehung des Long-/ Post-COVID-Syndroms als auch von ME/CFS beteiligt sind. Dem Nachweis von funktionellen Autoantikörpern – insbesondere gegen sogenannte G-Proteingekoppelte Rezeptoren (GPCR) – fällt daher eine wichtige Rolle bei der Differentialdiagnostik zur Erkennung eines Postinfektionssyndroms zu. Die langfristigen Konsequenzen einer Infektion mit dem Viruserreger SARS-CoV-2 treten mit Voranschreiten der Infektionswellen immer stärker zutage. Zahlreiche Patienten leiden als Spätfolgen der Infektion an einer Palette andauernder oder neu auftretender Gesundheitsprobleme, die ab einer Zeitspanne von vier Wochen nach einer COVID-19-Erkrankung als Long-COVID-Syndrom oder PASC („post-acute sequelae of COVID-19“) und bei Persistenz der Beschwerden von zwölf Wochen oder mehr als Post-COVIDSyndrom (PCS) bezeichnet werden (Abb. 1). Die Symptome des Long-/Post-COVID-Syndroms können trotz anfänglicher Genesung von einer akuten COVID19-Episode sowie im weiteren Verlauf auch bei ursprünglich asymptomatischen Personen mit SARSCoV-2-Infektion auftreten [1]. Zum breiten Symptomspektrum des Long-/PostCOVID-Syndroms zählen pulmonale, kardiovaskuläre, hämatologische, rheumatologische, neurologische und endokrinologische Beschwerden, die einzeln oder in Kombination auftreten können [1]. Bei einem Teil der Patienten entwickelt sich zudem ein Symptomkomplex mit unterschiedlich ausgeprägten körperlichen und geistigen Beschwerden, der große Übereinstimmung mit dem der auch als chronisches oder postinfektiöses Erschöpfungssyndrom bezeichneten Erkrankung ME/CFS aufweist. Dabei werden am häufigsten Schwäche und Erschöpfung (Fatigue), Dyspnoe, Muskel-, Gelenk- oder Kopfschmerzen und Darmbeschwerden beobachtet, aber auch neurologische Störungen (Riech-, Geschmacksstörungen, Reizempfindlichkeit) und kognitive Beeinträchtigungen (Konzentrations-, Gedächtnisprobleme, „Brain Fog“). Vielfach wird ein Postinfektionssyndrom wie ME/CFS oder das Long-/Post-COVID-Syndrom auch von Kreislaufregulationsstörungen begleitet, die sich durch Benommenheit, Schwindel oder Tachykardie auszeichnen (posturales Tachykardiesyndrom, POTS).
| Seiten | 8 |
|---|---|
| Autor | Dr. rer. nat. et med. hab. Stephan Sudowe |