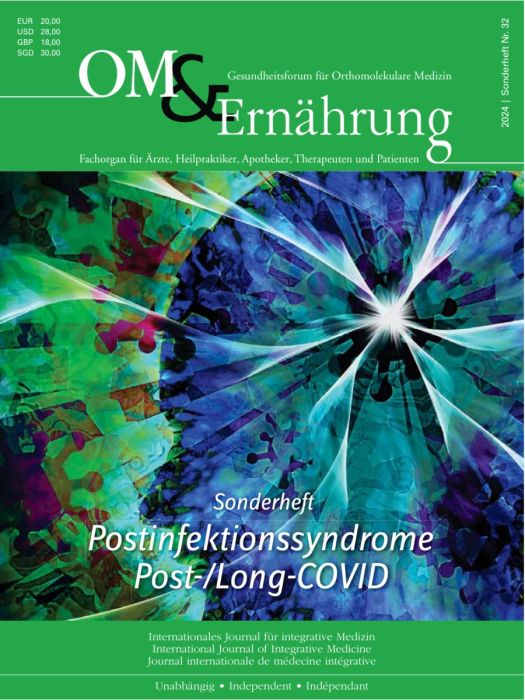Der Einfluss der Selenversorgung auf die Post-/Long-COVID-Symptomatik
Prof. Dr. med. Burkhard Schütz
Meike Crecelius, M. Sc.
Selen ist ein essentielles Mineral, welches über die Nahrung aufgenommen wird. Die Funktionen von Selen im Körper sind sehr vielfältig. Ein Selenmangel kann daher zu unterschiedlichen Symptomatiken führen. Da sich ein „marginaler“ Selenmangel häufig nicht in einer eindeutigen Symptomatik äußert, bleibt dieser nicht selten unentdeckt. In den mitteleuropäischen Ländern ist die Selenversorgung in der Regel nicht ausreichend und das Risiko für einen Selenmangel ist groß. Der Grund dafür ist der geringe Selengehalt der Böden, welcher sich auch in den Pflanzen widerspiegelt [1, 2]. Insgesamt variiert der Selengehalt sehr stark, die Böden in Amerika gelten beispielsweise als selenreich, während die europäischen Böden als sehr selenarm gelten. Sogar innerhalb deutscher Böden gibt es Schwankungen. Der Selengehalt von Nahrungsmitteln, welche insbesondere auf selenarmen Böden angebaut werden, ist sehr gering. Eine gute Selenversorgung ist daher selbst mit einer ausgewogenen Ernährung kaum möglich [1 – 5]. Selen ist essentiell für die Produktion von Selenoproteinen. Diese enthalten alle die selenhaltige Aminosäure Selenocystein. Zu den Selenoproteinen zählen unter anderem Glutathionperoxidasen, Iodthyronin-Deiodasen, Thioredoxin-Reduktasen sowie das Selenoprotein P [6]. Selenoproteine übernehmen vielfältige Aufgaben wie z. B. die Synthese und den Abbau von Schilddrüsenhormonen, die Modulation des Immunsystems oder die Reparatur von Proteinund Lipidoxidationsprodukten [6, 7]. Das Selenoprotein P nimmt hierbei einen Sonderstatus ein, da es als Speicher- und Transportprotein das Selen an die Zielzellen verteilt. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen der Selenoproteine wird ein Selenmangel mit den verschiedensten Erkrankungen in Verbindung gebracht [8 – 10]. In Form der Glutathionperoxidase wirkt Selen als Schutz der DNA vor oxidativen Schäden. Weiterhin ist Selen über die Iodthyronin-Deiodasen an der Synthese und dem Abbau der Schilddrüsenhormone T3 und T4 involviert. Ein Mangel kann daher zu einer Hypothyreose führen [11]. Selen wirkt auch auf humorale und zelluläre Immunparameter, indem es die Aktivität von NK-Zellen und die Produktion von Antikörpern (v. a. IgG) stimuliert [12]. Ein Selenmangel muss nicht immer mit eindeutigen Symptomen einher gehen – es existiert kein typisches Symptombild. Aus diesem Grund bleibt ein Mangel oft unentdeckt [13]. Trotzdem sind geringe Selenspiegel mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko für z. B. chronische Erkrankungen und Entzündungen assoziiert [13].
| Seiten | 5 |
|---|---|
| Autor | Prof. Dr. med. Burkhard Schütz und Meike Crecelius, M. Sc. |