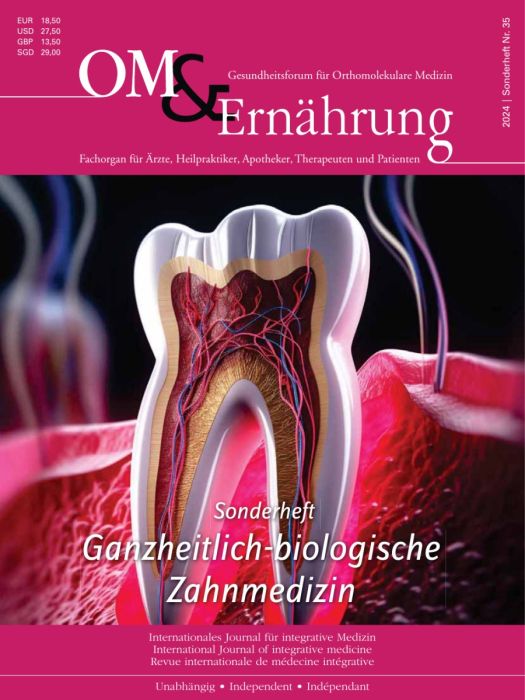Das Potential von Melatonin, Berberin und voll ozonisiertem Olivenöl in der Zahnheilkunde
Dr. med. Matthias Kraft
Dr. med. dent. Sarah Schomberg
Parodontitis/Periimplantitis – Pathogenese
Die Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparates. Über das sogenannte „Parodontium“ sind die Zähne im Kieferknochen fest und dennoch beweglich verankert. Es besteht aus vier Komponenten: dem umgebenen Zahnfleisch, dem Wurzelzement, der darauf verankerten Wurzelhaut und dem knöchernen Zahnfach. Eine Parodontitis wird durch verschiedene Faktoren begünstigt, die das Immunsystem sowohl im Mund, als auch systemisch unterhalten. Oberflächliche und zum Teil tief liegende Zahnbeläge (Plaque und Zahnstein) durch unsachgemäße Mundhygiene und hochfrequente Zufuhr kurzkettiger Kohlehydrate (Zucker, Weißmehlprodukte, Süßes, Obst etc.) sind Hauptauslöser dieser Problematik auf der einen Seite. Ebenfalls spielt ein geschwächtes Immunsystem (auch im Rahmen einer „silent inflammation“) hierbei eine wichtige Rolle, da es der bakteriell und entzündlich bedingten Zerstörung des Zahnhalteapparates und dessen Folgen keine ausreichende Abwehr entgegensetzen kann. Das ökologische Gleichgewicht im Mund wird durch die übermäßige Vermehrung oder den Verlust bestimmter Bakterien oder Pilze gestört (Abb. 1). Die Produktion von Exopolysacchariden (EPS) durch Mikroorganismen wie z. B. Streptococcus mutans, die Bildung von H2O2 durch Streptococcus gordonii oder durch Actinomyces naeslundii sezernierte alkalische Substanzen, können das ökonomische Milieu in der Mundhöhle negativ beeinflussen. Die Folge ist eine Anreicherung verschiedener pathogener Bakterien auf der Zahnoberfläche. Kommunikationssysteme zwischen den Bakterien ermöglichen es diesen, Informationen über ihre Umgebung, ihren Stoffwechsel und andere Überlebensinformationen zu verbreiten, was eine Reihe von Reaktionen auch systemisch im Körper auslösen kann. Bei gram-positiven Bakterien wird das sogenannte Quorum Sensing (QS) durch Peptidpheromone koordiniert, die als extrazelluläre Signalmoleküle Veränderungen in der Genexpression induzieren und letztlich so eine koordinierte Reaktion der Population auslösen [1,2]. Dieses QS-System spielt eine Schlüsselrolle bei der Anpassung an die teils ungemütlichen Umweltbedingungen der Bakterien. Anpassungsmechanismen umfassen u.a. die orale Biofilmbildung, epigenetische Regulation, die Säureproduktion, die bakterielle Virulenzaktivität und die EPS-Produktion [3 – 5]. Zwei Peptid-Pheromone, der „Auto-Inducer-2“ (AI-2) [6] und das „CompetenceStimulating Peptide“ (CSP) [7], werden von den meisten oralen Bakterien zur Kommunikation für die Biofilmproduktion verwendet und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung derselbigen. Das QS-System und die AI-Sekretion hängen von der bakteriellen Zelldichte ab. Bei einer geringen Zelldichte und in der planktonischen Phase werden die „AIs“ nicht besonders stark exprimiert und diffundieren einfach weg.
| Seiten | 8 |
|---|---|
| Autor | Dr. med. Matthias Kraft und Dr. med. dent. Sarah Schomberg |